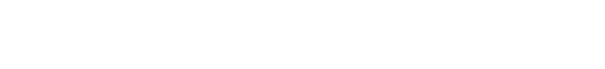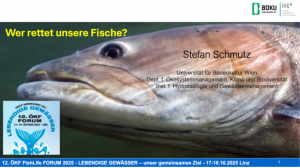
Im Vortrag „Wer rettet unsere Fische?“ zeigte Stefan Schmutz (BOKU Wien), dass es den heimischen Fischen schlecht geht: Rund 61 % der Arten sind gefährdet oder verschwunden. Früher lebten in Flüssen 200–300 kg Fisch pro Hektar, heute gelten schon 50 kg Fischbiomasse pro Hektar als ökologisches Minimalkriterium. Obwohl Österreich 2024 bereits 94 % seines Stroms aus erneuerbaren Quellen erzeugte und Laufkraftwerke wegen Photovoltaik zeitweise um die Mittagszeit abgeschaltet werden, wird weiter über neue Wasserkraftwerke nachgedacht. Ihr Ausbaupotential ist jedoch gering im Vergleich zu Wind, Sonne und Biomasse. Schmutz betonte, dass die Politik gefordert ist, keine weiteren Erleichterungen für Wasserkraft im neuen Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz zuzulassen. Gefordert sind jedoch WIR ALLE mit einem Aufruf zu Stellungnahme gegen das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz: Keine vereinfachten Verfahren und kein überragendes öffentliches Interesse für Wasserkraft.

„Die Angelfischerei im Fokus“ haben Sonja Behr (ÖKF) und Norbert Novak und präsentierten beeindruckende Daten, die zeigen, wie vielfältig und wertvoll die Angelfischerei in Österreich für Gesellschaft und Umwelt ist. Rund 690.000 Menschen in Österreich fühlen sich mit Fischen verbunden, 350.000 davon sind aktive Anglerinnen und Angler. Mit einem Marktwert von bis zu 800 Mio. Euro jährlich steht die Angelfischerei für wirtschaftliche Stärke, Ehrenamt und gelebten Naturschutz. „Bring them to the blue“ ist eine Einladung, neue Zielgruppen für die Angelfischerei zu gewinnen – Menschen, die bislang keinen direkten Bezug zur Fischerei haben, ihr aber offen oder neutral gegenüberstehen. Blau steht für Fischen und Wasser – für die Verbundenheit mit der Natur, Verantwortung gegenüber unseren Gewässern und die Freude am gemeinsamen Erlebnis. Wer diese Werte sichtbar macht, stärkt das positive Bild der Angelfischerei – wir alle sind ihre Botschafterinnen und Botschafter.
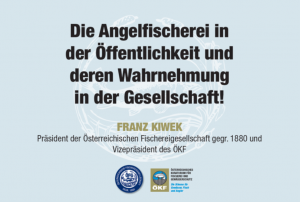
Im Vortrag „Die Angelfischerei in der Öffentlichkeit“ zeigte Franz Kiwek, wie entscheidend moderne Öffentlichkeitsarbeit ist, um der Fischerei mehr Akzeptanz zu verschaffen. Er machte deutlich, dass das Bild der Angelfischerei schon besser war – unter anderem wegen negativen Kampagnen radikaler Tierschutzgruppen, gesetzlichen Verschlechterungen und den Rückgang nutzbarer Fischbestände. Auch innerhalb der Fischerei müsse kritisch über Ihr Auftreten, aber auch über bisherige Besatzmaßnahmen reflektiert werden. Die entscheidenden Weichen werden jedoch in der Politik gestellt, weshalb die Fischerei ihre Interessen geschlossen und mit einer Stimme vertreten sollte. Kiwek appellierte, das Positive sichtbar zu machen, eigene Leistungen offensiv zu kommunizieren und die großen Herausforderungen aktiv in Öffentlichkeit und Politik zu tragen.
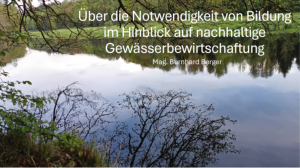
Bernhard Berger betonte die zentrale Bedeutung von Bildung für eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung. Nur wer ökologische Zusammenhänge versteht, kann Gewässer so pflegen und nutzen, dass sie auch kommenden Generationen artenreich, lebendig und nutzbar bleiben. Er ermutigte dazu, Wissen mit Mut und Geduld in die Praxis umzusetzen, denn je mehr Kenntnisse in der Bewirtschaftung Anwendung finden, desto hochwertiger ist letztlich auch das Ergebnis – beim Fisch ebenso wie beim gesamten Ökosystem. Ein fundiertes Bildungsangebot zu Themen wie Ökologie und Gewässerkunde, Fischbiologie und Fischgesundheit, fischereilicher Bewirtschaftung, Recht und Verwaltung sowie digitalen und zukunftsorientierten Entwicklungen steht in Verbänden, Vereinen, Fachliteratur und Tagungen in vielfältiger Form zur Verfügung.
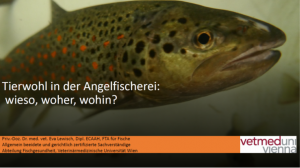
Tierwohl in der Angelfischerei wird von Eva Lewisch (Med.vet Universität Wien) thematisiert. Der Schutz von Ökosystemen und das Wohlergehen der darin beheimateten Fische sind vielen Anglern ein berechtigtes Anliegen. Auch der Tierschutz im Zusammenhang mit dem Angeln ist mittlerweile ins Bewusstsein der engagierten Angelfreunde eingedrungen, was sich in zahlreichen Broschüren, Publikationen und Schulungsinhalten widerspiegelt. Dabei stehen der Umgang mit dem Fisch und das Verhalten am Gewässer im Vordergrund. Relativ wenig hingegen werden nach wie vor die tierschutzrelevanten Aspekte des Fischbesatzes diskutiert. Diese betreffen sowohl die Besatzfische selbst, als auch den bereits vorhandenen Bestand. Ausschlaggebend sind in diesem Zusammenhang gewässerspezifische und ökologische Faktoren, genetische Eigenschaften der Fische, Vorhandensein und mögliche Verbreitung von Krankheitserregern und Managementmaßnahmen. In dem Vortrag sollen die wichtigsten Parameter aufgezeigt und Denkanstöße geliefert werden.

Siegfried Unz stellt in seinem Beitrag „Digitalisierung im Vereinswesen“ praktische IT-Lösungen vor, die die Vereinsarbeit moderner und einfacher machen. Dabei werden digitale Prozesse für Vorstandsaufgaben wie Buchhaltung, Zahlungsverkehr, Protokolle, Kommunikation und Statistik ebenso behandelt wie Anwendungen für Mitglieder und Angler (Fischerkarte, Kartenkauf, Fangbuch) sowie für aktive Mitglieder (Aufseher, Revierbeauftragte, Fischbesatz, Gewässerbeobachtung). Ein zentrales Thema ist der sorgsame Umgang mit Datenschutz, Urheberrechten und dem Recht am eigenen Bild. Diese Themen sowie konkrete Beispiele und Tipps für digitale Tools werden auf der Mittelseite von FishLife 3/2025 ausführlich vorgestellt.

Mit seinem Beitrag Angeln wir uns die nächste Generation zeigt Siegfried Unz zeigt, wie man mit einfachen Mitteln Kinder für Natur und Fischerei gewinnen kann. Kinder lernen spielerisch die Natur entdecken, sie zu respektieren und zu schützen, während sie gleichzeitig wichtige Fähigkeiten wie Neugier, Geduld und Verantwortungsbewusstsein entwickeln. Der Tagesablauf bei einem naturpädagogischen Programm gliedert sich in mehrere Stationen. Zuerst werden in der Schauzone Wasserbewohner beobachtet und deren Bedeutung erklärt. In der Touchzone dürfen Kinder die Tiere anfassen und erleben. Die Fischverarbeitung vermittelt, wie Fisch fachgerecht verarbeitet wird. Mit Becherlupen und Mikroskopen erforschen die Teilnehmer kleine Wasserlebewesen und Plankton. Gemeinsam wird geangelt, wobei Geduld und Naturerlebnis im Vordergrund stehen. Zum Abschluss werden die Lebewesen behutsam zurück in ihre Umgebung gesetzt, und die Kinder für ihr Engagement und Interesse an der Natur gelobt. Dieses Konzept kombiniert Wissensvermittlung und praktisches Erleben, um Kinder spielerisch für Umwelt- und Naturschutz zu begeistern.

Impulse für die Zukunft mit „Jungen Talenten & starken Frauen“ zeigt uns Ramona Hani. Mit großer Leidenschaft setzt sie sich für mehr Frauen und junge Menschen in der nachhaltigen Fischerei ein. Ihre Initiativen zeigen, wie Begeisterung für das Angeln mit Gemeinschaft, Innovation und Naturverbundenheit verbunden werden kann. Unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ laden die Fishing Ladies Austria regelmäßig zu Treffen und Veranstaltungen ein, um ein österreichweites Netzwerk für Austausch, Inspiration und gegenseitige Unterstützung zu schaffen. Auch für Kinder und Jugendliche gilt es, sie von der digitalen Welt zurück zur Natur zu führen. Junge Menschen bringen frische Ideen, Energie und neue Technologien in die Fischerei ein – von Drohnen und Sonarsystemen bis zu nachhaltigen Fangmethoden und modernen Ausbildungsprogrammen. Am Wasser geht es um Achtsamkeit, um das Erleben von Fluss, Fisch und sich selbst. Ramona Hani motiviert dazu, die nächste Generation und insbesondere Frauen für das Fischen zu gewinnen – denn jede engagierte Dame ist ein Gewinn für die Zukunft der Fischerei.
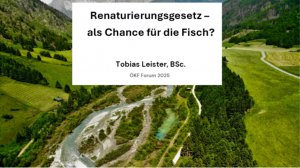
Tobias Leister erläutert das EU-Renaturierungsgesetz sowie dessen Bedeutung für lebendige Flüsse. Die EU-Mitgliedstaaten sind verpflichtet, bis 2030 insgesamt 25.000 Kilometer Flüsse EU-weit in einen frei fließenden Zustand zu versetzen. Österreich hat sich vorgenommen, 500 Flusskilometer zu renaturieren, tatsächlich wurden zwischen 2020 und 2025 aber nur 22 Kilometer rückgebaut – ein Zeichen für Herausforderungen wie Finanzierungsbedarf und die notwendige politische Zustimmung. Die Studie „Free Flowing Rivers“ weist rund 1000 Kilometer mit hohem Renaturierungspotential aus, wo gezielte Maßnahmen – mit wenig Aufwand und großem Gewinn für die Biodiversität – möglich sind. Aktuell erfolgt die Identifizierung geeigneter Strecken, ein Entwurf für konkrete Maßnahmen ist im 1. Quartal geplant.
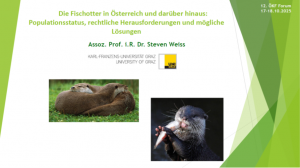
Steven Weiss erläuterte in seiner Präsentation den Schutzstatus und die Herausforderungen beim Fischotter in Österreich. Der Fischotter ist in Österreich laut FFH-Richtlinie in Anhang II und IV gelistet, was bedeutet, dass er streng geschützt ist. Anhang II verpflichtet dazu, einen günstigen Erhaltungszustand der Art sicherzustellen, während Anhang IV den Schutz jedes einzelnen Tieres vorschreibt. Im laufenden Berichtszeitraum 2019–2024 an die EU-Kommission Damit könnte der Fischotter erstmals seit 1992 als „günstig erhalten“ gelten. Aktuelle Untersuchungen zeigen inen deutlichen Populationszuwachs: In der Steiermark um etwa 25 %, in Kärnten um 34 %, mit Dichten in den einzelnen Bundeländern von 5,4 bis 7 Tieren pro 100 km². Ein zentrales Problem ist jedoch das Fehlen klarer Referenzwerte (FRVs), die zur Beurteilung des Erhaltungszustands notwendig wären. Österreich orientiert sich bislang am historischen Verbreitungsgebiet, was laut Weiss nicht der Intention der EU entspricht. Gefordert seien nachhaltige, realistische Populationsziele. Weiss empfiehlt kurzfristig, dass Regierungen solche Referenzwerte festlegen, und langfristig, den Anhang-IV-Status des Otters zu überdenken, um ein flexibleres Management zu ermöglichen. Er ruft Fischereiorganisationen dazu auf, diese Schritte aktiv zu unterstützen, um Konflikte zwischen Artenschutz und Nutzung besser zu lösen.

Phillip Schmitt (BOKU Wien) präsentiert mit ProtectFish – EU-weites Kormoranmanagement ein innovatives Forschungsprojekt gegen Kormoran-Prädation. Das EU-Projekt „ProtectFish“ (2024–2028) erforscht den Konflikt zwischen Kormoranen und gefährdeten Flussfischen, um wissenschaftliche Grundlagen für ein europaweites Kormoranmanagement zu schaffen.Im Fokus steht das Arbeitspaket „Fischartenschutz“, das die Auswirkungen verschiedener Managementansätze auf Kormoranbestände, ihr Verhalten und den Fraßdruck untersucht. An der Oberen Drau wird über drei Jahre die Wirkung einer kontrollierten Bejagung auf Bestand und Prädationsdruck analysiert. Dazu werden PIT-Tags, Wildtierkameras und jährliche Elektrobefischungen eingesetzt, um Zusammenhänge zwischen Management, Kormoranaktivität und Fischbeständen zu bewerten. Darüber hinaus erfasst das Projekt den europäischen Kormoranbestand, definiert Kriterien für einen „günstigen Erhaltungszustand“ und bewertet den Status gefährdeter Flussfischarten neu. Die Ergebnisse sollen praxisorientierte Empfehlungen für Fischereiverwaltungen, Naturschutz und Politik liefern und zum langfristigen Schutz heimischer Flussfische beitragen.
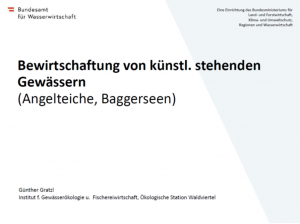
Günther Gratzl (BAW Ökologische Station Waldviertel) vermittelt in seinem Beitrag Bewirtschaftung künstlicher Gewässer wie Angelteiche und Baggerseen ökologisch aufgewertet werden. Er zeigte auf, wie Angelteiche und Baggerseen ökologisch aufgewertet werden können. Durch das steigende Interesse an der Angelfischerei werden solche künstlichen Gewässer zunehmend genutzt. Fischteiche sind meist flach, nährstoffreich und lichtdurchflutet, wodurch sie eine hohe Fischdichte erlauben. Baggerseen dagegen sind nährstoffarm, vom Grundwasser durchströmt und schwieriger zu bewirtschaften. Fehler lassen sich hier nur schwer korrigieren. Zentrales Ziel ist es, Strukturvielfalt zu schaffen – etwa durch Flachwasserzonen, Laichhabitate mit Kies oder Schotter, Pflanzenbewuchs, Totholz, Halbinseln und Buchten. Gratzl plädiert für „Mut zur Unordnung“, um stabile Fischbestände aufzubauen. Beim Fischbesatz ist auf eine passende Artenzusammensetzung und einen ausgewogenen Raubfischanteil zu achten. Entnahmefenster können zur Regulierung beitragen. Strukturreiche Gewässer fördern nicht nur die Biodiversität, sondern auch das Naturerlebnis für den Menschen. Gratzl betont, dass erfolgreiche Bewirtschaftung Geduld und realistische Erwartungen erfordert.
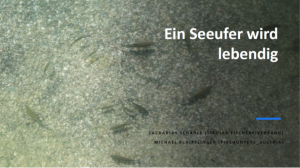
Im Beitrag „Neuer Lebensraum Walchsee zeigen Michael Schipflinger & Zacharias Schähle
zeigen ein erfolgreiches Renaturierungsprojekt am Walchsee. Das ehemals monotone Schlammufer wurde durch gezielte Kiesschüttung in einen strukturreichen Lebensraum verwandelt. Schon kurz nach Fertigstellung konnten zahlreiche Fischarten wie Laube, Hecht, Barsch, Zander, Brachse und Aitel beobachtet werden. Flachwasserzonen mit Kiesstruktur sind besonders wertvoll für die Laichablage, Jungfischhabitate und Nahrungssuche. Gleichzeitig beeinflussen sie die Carrying Capacity – die maximale Tragfähigkeit des Gewässers für Fischpopulationen. Durch die Schaffung neuer Strukturen steigt die Kapazität des Ufers, mehr Fische nachhaltig zu beherbergen, ohne dass die Qualität des Lebensraums oder der Bestand gefährdet wird. Gleichzeitig appellieren die Vortragenden, Laichfische zu schützen und Entnahmefenster anzuwenden, um die nachhaltige Nutzung der Fischbestände zu sichern. Filmhinweis: Einen kurzen Film zur Maßnahme finden Sie auf der Website des Tiroler Fischereiverbands: Neuer Lebensraum am Walchsee geschaffen: Ein Ufer wird lebendig!

Johann Spreitzhofer gab praxisnahe Tipps zur standortgerechten, fischfreundlichen und klimaresilienten Ufergestaltung. Hintergrund sind steigende Gewässertemperaturen, die Auswirkungen der Klimaerwärmung sowie Probleme wie Biberfraß und der daraus folgenden Verkahlung der Ufervegetation. Er wies darauf hin, dass rechtliche Vorgaben für öffentliches Wassergut zu beachten sind und dass Kahlschläge oft aus Hochwasserschutzgründen erfolgen, jedoch ökologische Nachteile mit sich bringen. Bei beengtem Raum können z. B. hohe Bäume an der Böschungsoberkante für Schatten sorgen und so eine starke Aufwärmung des Gewässers verhindern. Spreitzhofer stellte geeignete Bauarten für weiche und harte Auen vor, darunter auch Fischwälder aus Weidengeflecht, und betonte die Wichtigkeit des Schutzes nach der Pflanzung. Fischwälder aus Weidengeflecht verbinden Uferstabilisierung, Lebensraum für Fische und ökologische Aufwertung in einer einfachen, naturnahen Bauweise. Ziel ist es, die Uferstruktur langfristig zu stabilisieren und gleichzeitig Lebensraum für Fisch und andere Wasserorganismen zu schaffen.

Günther Unfer beleuchtet die Herausforderungen die Wasserkraft zu bewältigen hat, um tatsächlich nachhaltig zu arbeiten und beleuchtet dazu die ökologische Situation der Flüsse in Österreich. Große Flüsse über 10 m Breite (8.355 km) werden zu 47 % für Wasserkraft genutzt. Dabei führen kraftwerksbedingte Probleme wie unzureichende Restwasserabgaben, fehlende Durchgängigkeit (Kontinuum), Stauungen und plötzlich auftretende Wasserstandsschwankungen – sogenannte Schwall- und Sunk-Effekte – nach wie vor zu erheblichen Belastungen für die Fischfauna. Tödlich für Fischlarven sind Wasserstandsschwankungen von mehr als 0,2 cm pro Minute. Ein neuer Problemkreis sind die „Hydro-fibrilations“, anthropogen verursachte Wasserstandsänderungen, die etwa durch Abschaltungen von Kraftwerken während hoher Photovoltaik- oder Wind-Stromerzeugung entstehen können. Als positives Beispiel nannte Unfer die geplante Schwallausleitung an der Möll, wo über einen Stollen eine etwa 25 Kilometer lange Flussstrecke saniert werden kann. Durch zurückgehaltenes Sediment verfüllte Stauräume und deren Management werden wohl ein Hauptproblem der nahen Zukunft. Bei Spülungen freigesetzte Feinsedimente führen u. a. zu Sauerstoffdefiziten, Verfüllung von Schotterlücken und Schäden an Laichhabitaten. Anschauliche Praxisbeispiele wie das KW Hausmening zeigen, dass Schotter nach dem Ausbaggern wieder unterhalb des Staubereiches eingebracht werden kann, um ökologische Schäden zu minimieren. Seit Inkrafttreten der WWRL wurden in Österreich 1.628 Fischaufstiegsanlagen (FAHs) errichtet, davon 1.113 an Wasserkraftwerken; aktuell sind 771 funktionsfähig. Der Sanierungs- und Errichtungsbedarf bleibt aber hoch. Leider fehlen Konzepte zur Umsetzung von Fischschutz- und Fischabstiegsanlagen bis dato eigentlich noch vollständig. Auch bei Restwassermaßnahmen ist rund die Hälfte der Sanierungen noch offen.
Hinweis auf die behandelten Artikel:
- „Beitrag einer nachhaltigen Wasserkraft zum Schutz der Fische“
- „Wie problematisch sind Stauraumspülungen aus Sicht der Fischökologie? Ein Überblick mit Fokus auf eine fischökologische Fallstudie an der Unteren Möll“ –
- Gegenkommentar der Wasserkraftbetreiber: „Kontrollierte Stauraumabsenkungen hatten keine nachweisbaren Auswirkungen auf die Fischpopulationen der Möll.“
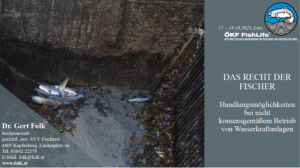
Im Beitrag „Das Recht der Fischer bei Wasserkraftanlagen“ erklärt Gert Folk Handlungsmöglichkeiten bei unzulässigem Betrieb von Wasserkraftwerken.

Clemens Gumpinger zeigt in seiner Präsentation „Dam Removal – Weg mit den Barrieren“ wie das Entfernen von Querbauwerken Flüsse ökologisch stärkt. In Österreich wurde zwischen 2006 und 2021 die Längs-Durchgängigkeit an rund 1.665 Standorten verbessert. Dennoch bestehen weiterhin etwa 28.000 Barrieren, die für Fische unpassierbar sind. Häufig werden Fischaufstiegsanlagen eingesetzt, von naturnahen Umgehungsgerinnen bis zu technischen Einrichtungen. Ihre Wirksamkeit ist jedoch nur teilkompensatorisch, insbesondere für stromabwärts gerichtete Wanderungen. Studien zeigen, dass die Beseitigung von Barrieren effektiver und kostengünstiger ist als der Bau von Fischaufstiegen (Birnie-Gauvin et al., 2018). In Europa wurden in den letzten drei Jahrzehnten über 5.000 Hindernisse entfernt, mit Vorreitern wie Frankreich, Schweden und Finnland. In Österreich wurden zuletzt etwa 200 kleine Querbauwerke beseitigt. Trotz dieser Fortschritte bleibt der Anteil der entfernten Barrieren im Vergleich zum Gesamtbestand gering. Erfolgreiche Beispiele in Österreich verdeutlichen den Nutzen von Dam Removal: An der Trattnach konnten sieben Querbauwerke entfernt und damit ein zusammenhängender Lebensraum für Fische wiederhergestellt werden. Am Lech wurde die Hornbachsperre beseitigt, und an der Maltsch wurden zehn Querbauwerke entfernt, um die Durchgängigkeit und ökologische Vernetzung der Flüsse zu verbessern. Solche Maßnahmen führen nicht nur zu einer sichtbaren Verbesserung der Fischpopulationen, sondern fördern auch die gesamte Biodiversität im Gewässersystem. Für eine verstärkte Umsetzung von Dam-Removal-Maßnahmen sind mehrere Rahmenbedingungen notwendig. Ein Entscheidungswerkzeug, das die Wirtschaftlichkeit bestehender Kraftwerke konsensual bewertet, sowie Förderinstrumente mit ökologischem Schwerpunkt erleichtern die Realisierung. Außerdem bedarf es einer klaren rechtlichen Grundlage, die die Entfernung nicht mehr genutzter oder ökologisch schädlicher Querbauwerke ermöglicht, sowie einer gewichteten Berücksichtigung des öffentlichen Interesses, bei der die ökologische Funktion der Flüsse einen höheren Stellenwert einnimmt.